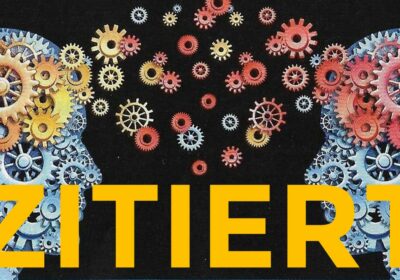Zwang zum Risiko

Leo Furtlehner über die Forderung nach Finanzwissen.
Dem neoliberalen Kapitalismus genügt es nicht, dass Lohnarbeitende ihre Arbeitskraft dem Kapital zur Verfügung stellen, damit jene, die im Besitz der Produktionsmittel sind vom produzierten Mehrwert kräftige Profite abschöpfen und ihren Reichtum mehren können.
Vielmehr wird heutzutage verlangt, dass die Unselbständigen mit vollem Risiko den Kapitalmarkt bedienen. Dazu wird mangelndes Finanzwissen beklagt und darauf gedrängt, dieses „Wissen“ möglichst schon in den Schulen zu vermitteln. Den Apologeten der „freien Marktwirtschaft“ geht es aber nicht darum, gesellschaftlich relevante Zusammenhänge deutlich zu machen. Ihre Absichten zielen vielmehr darauf, auch die „kleinen Leute“ zu riskantem Verhalten am Kapitalmarkt zu ermuntern.
Risiko überall
Ganz in diesem Sinne zeigen uns im „Standard“ (6.3.2021) Leopold Stefan und Aloysius Widmann „Weg zum Vermögen“, denn „die Zeiten, in denen man Geld risikofrei, aber gut verzinst bei der Bank anlegen konnte, sind vorbei.“ Freilich ist auch die Veranlagung überflüssigen Geldes in „Betongold“ nicht mehr das Gelbe vom Ei, denn „auch der Immobilienbesitz geht mit Risiken einher“. Neben der Gefahr eines „Klumpenrisikos“ – 2007 in den USA Auslöser der globalen Finanzkrise – braucht man, um Immobilien zu kaufen „Startkapital, sei es geerbt oder geschenkt“.
Empfohlen wird daher „die Angst vor Aktien ablegen“. Der Ratschlag sorgt jedoch für Verwirrung, denn „Wer kurzfristig Aktien handelt, investiert nicht, sondern spekuliert. Auch wer langfristig in Wertpapiere anlegen will, braucht gute Nerven.“ Also was jetzt wirklich? Da tröstet auch die Empfehlung „Ein Aktienfonds lässt sich Monat auf Monat auch mit kleinen Summen speisen“ nicht wirklich.
Erben empfohlen
Das Finanzwissen Marke „Standard“ wird schlussendlich auf zwei sehr weise Empfehlungen reduziert: „Die beste Chance, etwas Vermögen aufzubauen, habe man mit einem stabilen Einkommen“. Und „Der einfachste Weg zum Vermögen ist ein anderer: Erben“. Wie man ein (langfristig) sicheres Einkommen in diesen (unsicheren) Zeiten hat, wird allerdings ebenso wenig erklärt, als auch wie man zur entsprechenden Erbschaft kommt.
Die „OÖ Nachrichten“ veranstalten zur Steigerung des Finanzwissens schon seit Jahren gemeinsam mit Raiffeisen ein insbesondere an Schulen beworbenes „Börsespiel“. De facto eine Einstiegsdroge, um der Jugend die Finessen des Finanzmarktes nahe zu bringen. Auch 2021 befeuert das „Landeshauptblatt“ gemeinsam mit der „Landesbank“ die Spekulation und freut sich über mehr als 7.000 Anmeldungen (OÖN, 16.2.2021).
Als Draufgabe gab es die Empfehlung „5 Fallen beim Kauf von Aktien“ (OÖN, 27.2.2021) die da wären „1. Grundkenntnisse, 2. Alles auf ein Pferd setzen, 3. Kurzfristig gedacht, 4. Gierig sein“. Also eigentlich Ratschläge, die Finger von Aktien zu lassen. Weil das aber nicht sein darf, gilt als letzte Falle „5. Keine Aktien kaufen“.
Da dürfen andere Banken nicht zurückstehen. So bietet die Erste Bank mit ihrem „Financial Life Park“ einen „Lernparcours“ an, um Kindern die Finanzwelt zu veranschaulichen (Standard, 3.3.2021). Laut den hauseigenen, natürlich völlig uneigennützig agierenden Experten würde nämlich „mehr Finanzwissen Menschen zu mehr Wertpapieranlagen führen“.
Frauen im Fokus
Dabei gibt man sich mit Verweis auf eine IMAS-Studie ganz feministisch. Frauen würden ihre Unabhängigkeit „als sehr wichtig ansehen“, aber bei der Geldanlage viel zu zögerlich sein, im Klartext das Risiko scheuen. Dass Frauen finanziell „immer noch oft deutlich schlechter“ dastehen als Männer ist eine Binsenweisheit: Sie verdienen durchschnittlich um ein Fünftel weniger als Männer, arbeiten zu 46,7 Prozent in Teilzeit und ihre Pensionen liegen mit durchschnittlich 1.064 Euro deutlich unter der offiziellen Armutsgrenze von 1.259 Euro. Der Sager von ÖVP-Frauenministerin Susanne Raab “Je mehr und je früher Mädchen und Frauen an die Themen Finanzen, Pensionsvorsorge und Geldanlage herangeführt werden, desto besser.” (OTS0039, 19.2.2021) ist daher purer Zynismus.
Das Objekt der Begierde der Banken sind jene 274 Milliarden Euro die faktisch unverzinst auf Sparbüchern liegen. Durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank – die angeblich die Inflation beseitigen sollte – sind vor zehn Jahren auf ein Sparkonto angelegte 10.000 Euro mit Einrechnung der Inflation heute nur mehr 8.633 Euro wert. Im Klartext genügt es den Banken nicht, dass sie für die Spargelder ihrer Kund*innen keine Zinsen zahlen, aber damit profitabel Kredite vergeben dürfen und als Draufgabe für Girokonten kräftig mit Spesen abkassieren.
Vielmehr wollen die Hohepriester des Neoliberalismus die Menschen ins volle Risiko treiben, um den Umverteilungsprozess nach oben zur Bereicherung des obersten einem Prozent der Gesellschaft weiter zu verstärken. Ganz so, als ob es nicht schon unerträglich wäre, dass das reichste Prozent 39,9 Prozent, hingegen die ärmsten 50 Prozent nur 2,8 Prozent des Vermögens in Österreich besitzen (ÖNB 2020).
Leo Furtlehner ist verantwortlicher Redakteur der „Arbeit“