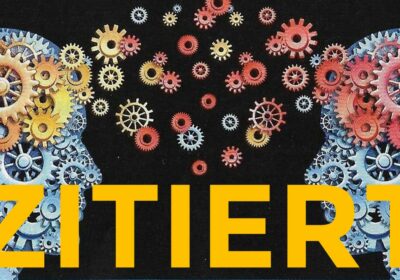Zeit für eine Kunst-Revolution

Dominika Meindl zur aktuellen Kulturpolitik
Corona hängt uns allen zum Hals heraus, in beiderlei Wortsinn: Das depperte Virus nistet sich erstens in unserem Rachen ein und zweitens eint uns seit Wochen eine Epidemie-Fatigue. Es ist noch schwerer geworden, etwas zu schreiben, das auch in fünf Monaten Relevanz hat.
Doch keine Sorge, mit der Pandemie sind wir eigentlich schon wieder fertig. Denn die Lage von Kunst und Kultur war schon lange vor dem Lockdown mies. Und das ist ein großes Problem – nicht allein für die Menschen, die von ihrer künstlerischen Arbeit leben wollen, sondern für die Gesellschaft. Fast muss man dankbar sein, weil Corona wie ein Sturm in den Verblendungszusammenhang gefahren ist und den Nebel über der Misere verblasen hat.
Wir wollen über Ulrike Lunaceks Performance als Kulturstaatssekretärin nicht mehr sprechen, weil wir die Rede von „Perfomances“ hassen, und weil darüber zu reden hieße, über den neoliberalen, leistungsversessenen Senior-Koalitionspartner zu schweigen. Wir müssen uns dringend gegen den Platz wehren, den die türkise Kulturpolitik den Kunstschaffenden zuweisen will, denn es ist jener der Almosenempfänger*innen und Hofnärr*innen.
Die Dramaturgie des Lockdowns eignet sich zum Vergleich. Die Leistung der Schaumweintrinker, Wirtschaftskammerobmänner, Flugkonzernmanager, Jagdpächter und konservativen Parteiobmänner (wir gendern hier absichtlich nicht) beim Wiederaufbau des Landes wird sich lohnen, vielen Dank an die Gattinnen, die im Haushalt und Kinderbetreuung den Entscheidern den Rücken freigehalten haben, Applaus! Wir wollen nicht ungerecht sein.
Viele der hart arbeitenden Lenker bekennen sich zur Kulturnation Österreich, und in ihrer kargen Freizeit lesen sie gerne einen guten Roman, gleich nach dem Triathlon-Training. Sie freuen sich auf die Leuchtturmprojekte beim großen Theatersommer. Ihre Kinder erhalten Klavierunterricht, ist ja gut für die neurale Entwicklung.
Wir wollen uns den Sarkasmus sparen. Die wenigsten Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen hatten gegen die Absage ihrer Veranstaltungen etwas einzuwenden; niemand hat Freude an der Arbeit, wenn sie andere gefährdet. Aber da ihnen die Regierung durch einen linguistischen Kniff den Anspruch auf Schadenersatz genommen hat (der bestünde nur bei einer EPIdemie, nicht aber bei einer PANdemie), müssen sie nun vor der Wirtschaftskammer oder den Landesregierungen die Hosen herunterlassen, obwohl das Finanzamt über die Lage der selbständigen Künstler*innen Bescheid wüsste.
Die Zahl der Bezugsberechtigten ist ohnehin gering, weil kaum noch jemand so vermessen ist, nur von der Kunst leben zu wollen. Das hört sich spätestens auf, wenn man Kinder haben will, oder auch nur ein halbwegs sorgenfreies Leben. Von neoliberaler Seite wird gern argumentiert, dass sich die echte Kunst ja „am Ende des Tages“ einen Weg bahnen werde; der Schaffensdrang sei eben nur bei den Genies groß genug – und wer permanent am Bedarf vorbei produziere, solle nicht am Subventionstropf hängen.
Das Versagen in der Kunst ist immer das Versagen des Individuums. Wer so denkt, glaubt wohl auch, dass der freie Markt die beste Schulbildung und das tollste Gesundheitssystem schaffe. Wie unglaublich naiv! Was man mit so einer Haltung erntet, sind noch mehr schreibende Ärztekinder wie die Autorin dieses Textes. Die sitzen in den geerbten Immobilien, die laut Bundeskanzler so gut gegen Altersarmut schützen. Im besten Fall denken sie über ihre Privilegien nach und erheben ihre Stimmen gegen diese Verarmung der Kunst.
Was ist denn Kultur noch wert, wenn sie mit den Menschen nichts mehr zu tun hat? Man muss nicht nur auf die Sommer-Stadion-Rock-Bühnen schauen, um lauter weiße Männer darauf zu sehen, auch die Literatur und die bildende Kunst und das Theater sind „autochthon“ und männlich, sobald sich damit Geld und Ruhm verdienen lassen. In den mittleren Ebenen finden sich dann wieder sehr viele Frauen, die halten das Prekariat aus guten und schlechten Gründen besser aus. Was die Migrant*innen zu erzählen hätten, interessiert höchstens die Akteur*innen der freien Szene.
Das Glück im Unglück unserer Branche ist, dass wir uns zumindest verbal Luft machen können. Gegen die Verhältnisse zu protestieren ist unser tägliches Brot, auch wenn wir absichtlich völlig unpolitische, hermetische Lyrik schreiben. Ein poetischer, nicht vermarktbarer Akt ist ein politischer Akt.
Wenn nur einmal die Kulturbudgets der Inflation angepasst würden, wäre schon viel gewonnen. Dazu eine gerechte Verteilung der Mittel zwischen den großen Institutionen und den kleinen Initiativen. Wer für Kunst und Kultur arbeitet, soll sich endlich nicht mehr rechtfertigen müssen, genauso wenig wie Ärzt*innen oder Lehrer*innen. Künstler*innen sind es – anders als die von den Balkonen beklatschten Krankenpfleger*innen und Supermarktarbeiter*innen – gewohnt, Applaus statt Geld muss aber generell aufhören. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für unseren Protest als jetzt, es gibt keinen besseren Zeitpunkt für ein massives Kulturkonjunkturpaket als jetzt.
Dominika Meindl ist Schriftstellerin, Journalistin, Regionalsprecherin der Grazer Autor*innenversammlung sowie Präsidentin der Lesebühne „Original Linzer Worte“