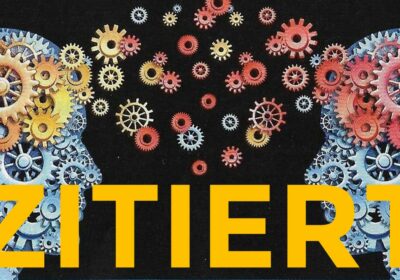Wozu brauchen wir die ÖBAG?

Leo Furtlehner über die Causa Schmid.
Als „extrem peinlich“ sieht Hans Rauscher die Chats der Kurz-Truppe „einerseits wegen des infantilen Bussi-Bussi-Tons und (politisch) gefährlich sind sie wegen des Machtmissbrauchs, der da durchschimmert“ (Standard, 7.4.2021).
Da hat sich Thomas Schmid – vormals Generalsekretär im Wirtschaftsministerium, seit 2019 Boss der Staatsholding ÖBAG – einen Superjob maßgeschneidert und dazu passend auch einen handverlesenen Aufsichtsrat. Die auf Schmids Smartphone gefundenen 300.000 Chats mit 80 Personen ist entlarvend und ein „Abgesang an die Wirtschaftspartei ÖVP“.
Entlarvende Chats
„Du musst mir echt helfen das neue Beteiligungsgesetz rasch umzusetzen! Das bist du mir echt schuldig!“ (Schmid an Blümel, 15.12.2017). „Bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate. Das wäre ja wie Wiener Stadtrat ohne Portfolio“ (Schmid an Kurz, 13.3.2018).
„SchmidAG fertig“ (Blümel, Dezember 2018). „Kriegst eh alles was du willst“ (Kurz an Schmid, 13.3.2019). „Ich bin so glücklich :-))) Ich liebe meinen Kanzler“ (Schmid an Kurz, 13.3.2019).
Nachdem die ganze Schmiere aufgeflogen ist, wurde die Notbremse gezogen: Schmids lukrativer Vertrag (Jahresgage 400.000 Euro plus 210.000 Euro Bonus) läuft 2022 aus und wird nicht verlängert. Ein Bauernopfer, damit Kurz, Blümel & Co. ungeschoren bleiben. Eine grundsätzliche Frage wird dabei wohlweislich nicht gestellt. Nämlich, warum wir überhaupt eine Konstruktion wie die ÖBAG brauchen.
Bekanntlich wies Österreich nach 1945 durch die Beschlagnahme deutschen Eigentums aus der NS-Ära einen hohen staatlichen Sektor auf. Die von den zwei Verstaatlichungsgesetzen 1946 und 1947 betroffenen Unternehmen wurden direkt von der Regierung bzw. den zuständigen Ministerien verwaltet. Ebenso legendär wie das „Königreich Waldbrunner“ des von 1949 bis 1962 agierenden SPÖ- Ministers Karl Waldbrunner war aber auch der Proporz, also die Aufteilung führender Posten in den Staatsunternehmen zwischen ÖVP und SPÖ, viel- fach Doppelbesetzungen inklusive.
Die „Entpolitisierung“ der Staatsbetriebe
Das änderte sich mit der Alleinregierung der ÖVP (1966-1970), welche die Verstaatlichte durch die Ausgliederung in die 1966 gegründete ÖIG (Österreichische Industrieverwaltungs GmbH) „entpolitisieren“ wollte und aus welcher 1970 die ÖIAG (Österreichische Industrieverwaltungs AG) entstand und von der SPÖ-Alleinregierung nahtlos übernommen wurde. 1970 wies die Verstaatlichte ein Viertel der Industriebeschäftigten und ein Fünftel der Exporte vor (Standard, 4.4.2021).
Die Verstaatlichte war als günstiger Lieferant von Rohstoffen und Halbfabrikaten für die Privatwirtschaft willkommen, ihre Ausweitung in die Finalindustrie sollte aber um jeden Preis verhindert werden. Stets ging es also darum, Exponenten des Privatkapitals in die Aufsichtsgremien der Staatsbetriebe zu schleusen.
Die Stahlkrise Anfang der 1980er Jahre wurde dann als willkommener Anlass genommen um „die Privatisierungsmaschinerie nach dem Fiasko der Verstaatlichten“ anzuwerfen“ (Eric Frey, Standard, 3.4.2021). Dazu versuchte man als Vehikel 1989 die ÖIAG-Tochterfirma Austrian Industries, die aber 1994 wieder mit der ÖIAG verschmolzen wurde. Von 1987 bis 2000 erfolgte dann – maßgeblich unter SPÖ-Regie, die von „sicheren inländischen Kernaktionären“ und „Mitarbeiterbeteiligungen“ schwadronierte – die Privatisierung des großteils der bisherigen Verstaatlichten. Der zuständige Minister Rudolf Streicher brachte das mit dem Sager auf den Punkt: „Unser Katechismus ist das Aktienrecht“ (Arbeit und Wirtschaft, 9/2000).
Beim EU-Beitritt Österreichs 1994 galt der starke staatliche Sektor als Hindernis: Staatsunternehmen würden „ausländische Übernahmen erschweren“, den „freien Kapitalverkehr behindern“ und den „Wettbewerb verzerren“ (Eric Frey, Standard, 3.4.2021).
Privatisierungsagentur
Im Jahre 2000 wurde die ÖIAG definitiv in eine Privatisierungsagentur umgewandelt und es folgte eine zweite Privatisierungswelle von 2000 bis 2009. 2015 entstand aus der ÖIAG die ÖBIB (Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH), die wiederum 2019 unter ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger in die ÖBAG (Österreichische Beteiligungs AG) umgewandelt wurde. Und da kam eben Thomas Schmid zum Zug, dem ein Portfolio von 27 Mrd. Euro aus elf Staatsbeteiligungen anvertraut wurde.
Sogar ÖBAG-Aufsichtsratschef Helmut Kern sieht die Situation als „ein Sittenbild, das niemanden glücklich macht“ (Standard, 1.4.2021). Da wäre es wohl sinnvoller, die Kompetenz für die restlichen Staatsbeteiligungen (OMV 31,5, Casinos 33,24, Telekom 28,42, BIG 100, Post 52,85, Verbund 51 Prozent) direkt an Ministerien zu übertragen, oder dafür eine Abteilung im Finanzministerium einzurichten. Von der Regierung Kurz ist hingegen nichts anderes zu erwarten, als dass sie privaten Interessenten noch mehr Einfluss auf Staatseigentum verschafft.
Leo Furtlehner ist verantwortlicher Redakteur der „Arbeit“